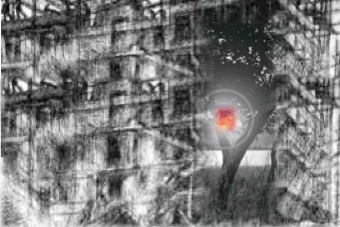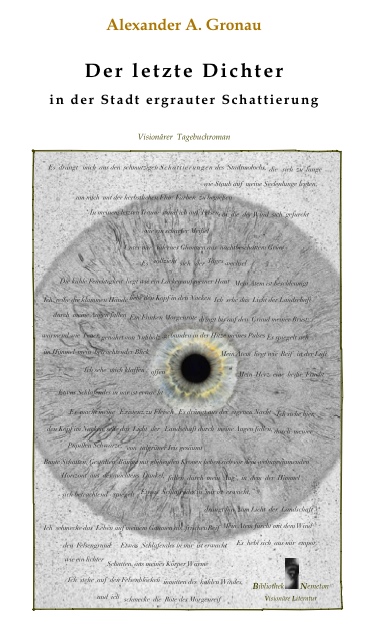* * * * * * * * * * * * * Morgens, 21. Februar 2039; die Sonne, die neunzig Prozent der Masse des Sonnensystems ausmacht, ist 149.600.000 km von der Erde entfernt; man würde anhand des schalen Lichtes, das die kontinentale Stadt seit einigen Jahren nur noch erreicht, vermuten, daß es eine weit größere Distanz ist, und sie sich zudem schleichend auswächst. Alle Dinge haben eine Grauschattierung angenommen: die gewöhnlichen, eng errichteten Wohnblöcke, die umzäunten, von Sicherheitsdiensten bewachten luxuriösen Hochbauten, die mittels Satelliten gesteuerten Fahrzeuge, welche gleichmäßig den linearen Gestaltungen des Straßennetzes folgen, die bemäntelten Passanten, die immer in hektischer Bewegung sind und nirgendwo anzukommen scheinen. Noch bezeichnender aber ist: niemals sprechen die Städter auf den Straßen oder öffentlichen Plätzen miteinander; es ist als kannten sie die Sprache des Nächsten nicht, als spräche jeder eine eigene Fremdsprache und durcheilte einen anderen fernen Raum. Jeder Ort wird mit Kameras und Mikrophonen amtlich überwacht; zur Sicherheit wurde die Freiheit schleichend abgeschafft. Viele Zonen dürfen die Städter nur zu bestimmten Tageszeiten und unter Vorlage ihres Paßes betreten, Bankenviertel wie zugepflasterte Parkanlagen. Alle haben sich an diese sonderbaren Umstände gewöhnt, da die Städter ihre abnorme Realität längstens für die einzig mögliche Wirklichkeit halten. Seit der Einführung der Wahrnehmungsreform vor etwas über zehn Jahren ist das Grauschattierte im Stadtstaat Europa unhinterfragtes, trauriges Fundament. Die Stadt wirkt von verheerenden Zuständen eingenebelt, so als wehten jene als farberaubender Schleier durch die Straßenschluchten. All das spiegelt sich an diesem gewohnt trüben Morgen einmal mehr grauschattiert in meinen Augen, deren grünes Farbmuster ich erst vor einiger Zeit wiederentdeckte; auch in der Beschaffenheit der Iris äußert sich die Identität eines Menschen, mehr noch als in einem Lächeln, einem Gesichtszug, schrieb ich damals auf einen Zettel, den ich gegenüber einem Spiegelsplitter an die Wand meiner Dachgeschoßwohnung hing, um diesen eigenen Gedanken zu vervielfältigen. Daneben hängt mein Bannspruch gegen das ergraute Treiben hinter dem Fenster. Für mich geht von seiner Bedeutung eine Kraft aus. Er schützt meinen inneren Raum wirkungsvoll. Er lautet: Jeder Mensch ist ein Bewußtseinsraum. Die Kraft dieser Erkenntnis benötige ich immer wieder, wenn ich mich wie jetzt frage, in welcher seltsam verblaßten Welt ich heute morgen einmal mehr erwacht bin! Ich blicke durch das Fensterglas meiner Wohnung erneut in den Moloch, der vor meinen grünen Augen nichts als ein lichtraubendes Monstrum, ein unkörperliches Etwas, ein gewaltsam atembeschwerendes Phänomen ist, das aus dem Asphalt der kontinentalen Stadt zu dringen scheint, der unter sich eine ganze natürliche Welt verschüttet hält. Die Straßenschluchten mit den hochaufragenden Bauten sind wie ungezählte, verglaste Schlünde, in denen der gesamte freie Raum der natürlichen Welt mitsamt der Vision von einem ungebundenen Menschsein grundlos gefallen ist; das zu denken überkommt mich, wenn ich in die Untiefen der Stadt blicke, die einen Sog auf mich ausüben, in dem ich oft zu ertrinken glaube. Was aber machte diese Stadt so grausam, warum ist sie unterschwellig unterkühlt, obgleich die Klimaerwärmung im Gange ist, jede Küste durch monströse Dämme gegen das Meer wie gegen einen Feind gerüstet ist? Meine Antwort fällt mir heute morgen etwas zufriedenstellender als üblich aus; es mehrt gering meine ungestillte Hoffnung irgendwann einen Ausweg aus der erdrückenden Gegenwart der Stadt zu finden: Sie muß ab einem gewissen Tag gegen die Natur selbst errichtet worden sein, gegen ihr innerstes Wesen. Ich maß auch kürzlich an gesonderten Stellen nach, und befand, daß sie vermehrt gegen den goldenen Schnitt verstößt, um sich Raum zu schaffen, wo keiner sein dürfte. Daraus resultiert in dieser Stadt meines Erachtens die Unmöglichkeit des Ankommens an einem wirklichen Ort und sind die Menschen unentwegt in dieser Hetze. Der einzig heile Ort innerhalb dieser grauschattierten Stadt ist dein Inneres! Ich trete von meinem Fenster und seiner unliebsamen Aussicht zurück. Ich glaube, daß der Prozeß des Grauwerdens in der Stadt derart allmählich vonstattengegangen ist, daß es keinem Bewohner auffiel. Daß dieser Verlust ein tatsächlicher ist, beweisen mir allein meine farbigen Kindheitserinnerungen. Ich kenne derzeit niemanden in der Stadt, der diesen Mangel erkennen würde und wie ich als unerträgliche Belastung empfindet; ich habe in den letzten Monaten angestrengt nach jenen Menschen gesucht; mit wachsamen Blick auf den übervollen Straßen, wo ich stets nach einer anderen farbigen Iris ausspähe. Im Internet suchte ich mit dem Stichwort “Farbträume“. Das Wort Farbe löst unter den Städtern größte Irritation aus. Und im Zusammenhang mit Träumen besonders. Inzwischen stehe ich vor dem Spiegel des Badezimmers im graubelegten Licht des frühen Tages, das durch das schmale Fenster betrüblich auf mich fällt. Ich betrachte mich: Ein Schleier hat sich auch in die Haut meines Gesichtes eingelegt. Es mißfällt mir! Ich ertappe mich dabei, wie ich in einem kurzen Anfall mir diesen Schleier mit bloßen Händen aus dem Gesicht zu reiben versuche. Zum Trost kann ich meine grünen Augen dagegensetzen, die in ihrer Farbe wie von dunklen Seen durchsäumte Wälder sind. Wälder, die ich allerdings wiederum nur aus den Traumgesichtern und den Streifzügen meiner Kindheit kenne, mit dieser lichten Farbe eines leuchtenden Grüns.
Ich mehre damit gezielt das Licht in meinen Räumen. Über allem in der Stadt hängt unentwegt und unentrinnbar dieser Schleier, der sich draußen auf den Straßen unerträglich kahl auf mein Befinden legt. Meine lichtmehrende Vorrichtung schützt mich in den eigenen vier Wänden einigermaßen vor diesem gemütbelastenden Eindruck. Ich versuchte vor wenigen Wochen Farben aus dem normalen Tageslicht herauszufiltern. Ich benutzte dazu ein Prisma. Ich hatte in einem Buch aus dem letzten Jahrhundert nachgelesen, daß es das Phänomen eines regenbogenfarbenen Spektrums ergäbe. Ich erhoffte mir leuchtende Farben von der Intensität meiner Träume. Ich hatte allerdings nur einen Teilerfolg. Ich sah tatsächlich einen Farbfächer, aber er krankte an einer Bläße, wie alles in der Stadt, mit Ausnahme meiner Augen und meines Haares vielleicht. Das Sonnenlicht selbst, das die Stadt erreicht, muß durch den Smog derart verunreinigt sein, daß seine Farben hochgradig “getrübt“ werden.
Ich frage mich, woher diese, in meinem realen Leben nie gesehenen Farben kommen, die mal sacht wie von Pastell und andernmals kräftig erdig in ihrem Charakter sind? Sie beginnen jetzt in der Erinnerung erneut meine Vorstellung zu füllen. Sie sind erfrischend wie kühles Wasser und heilsam für mich mit ihrer Helligkeit. Ich lege den Stift beiseite, schalte das Diktiergerät an und schließe die Augen. Ich möchte einen Blick wachsam in mein Inneres wenden, auch um meine inneren Räume zu erkunden; ich möchte die berührenden Szenen des Traums mir wieder imaginieren. Es geht mir um das Wiederauffindung des Selbst und seiner Farben. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
"Der letzte Dichter in der Stadt ergrauter Schattierung" Der letzte Dichter in der Stadt ergrauter Schattierung |